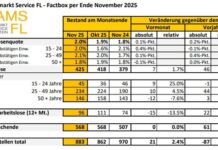Die Spielsucht hat in den vergangenen Jahren einen Quantensprung gemacht, betont Univ. Prof. Prim. Dr. Reinhard Haller und warnt vor den negativen Folgen – auch für das Umfeld der Betroffenen, die oft mit ins Elend gerissen werden.
Interview: Stefan Lenherr • Foto: presse-exklusiv-vaduz
«lie:zeit»: Herr Haller, wie würden Sie einem Laien erklären, was eine Spielsucht genau ist?
Reinhard Haller: Erst einmal muss man sagen, dass das Spielen an sich ein menschliches Grundbedürfnis ist. Der Mensch ist eben nicht nur Homo sapiens, also der denkende Mensch, oder Homo faber, der arbeitende Mensch, sondern eben auch Homo ludens, der spielende Mensch. Ich will das Spiel nicht verteufeln, es ist sehr wichtig für den Menschen, auch um zu lernen. Aber das Spielen kann eben auch Suchtcharakter annehmen. Es verhält sich dabei wie bei einer Heroin- oder Alkoholsucht, die Dosis – oder im Fall des Spielers der Einsatz – wird immer höher, dazu steigt die Frequenz. Spielsüchtige erleben psychische Entzugserscheinungen, werden nervös und unruhig, wenn sie nicht spielen. Der Unterschied zu einer Drogensucht ist, dass die Organe keinen Schaden nehmen. Aber sonst sind alle Kriterien für eine Drogensucht erfüllt.
Wo sehen Sie die Grenze zwischen unproblematischem Spielen und ersten Anzeichen eines Suchtverhaltens?
Die Grenze ist überschritten, wenn ich nicht mehr selber bestimme, ob ich spielen will, sondern die Sucht. Je stärker die Willensfreiheit eingeschränkt ist, desto problematischer wird es. Daneben kommt es zu einer stetigen Steigerung der Dosis und der Frequenz.
Wie viele Menschen sind von Spielsucht betroffen?
Die Spielsucht gehört zu den Verhaltenssüchten wie etwa die Internet- oder die Kaufsucht. Allerdings ist die Spielsucht unter den Verhaltenssüchten die am häufigsten auftretende. Nach neusten Erhebungen sind 2 bis 4 Prozent der Menschen spielsüchtig. Dieser Wert ist im Vergleich zu früheren Jahren ein Quantensprung. Die Zunahme lässt sich dadurch erklären, dass die Verfügbarkeit der Droge sehr hoch ist. Dank des Internets kann jeder Tag und Nacht an seinem Computer spielen.
Wie kann man Spielsüchtigen am effektivsten helfen?
Eine Spielsucht ist nur die Spitze des Eisbergs. Meistens haben die Betroffenen bereits mit psychischen Problemen wie Angststörungen oder Depressionen zu kämpfen. Die innere Leere versuchen sie mit dem Spielen zu füllen. Um einem Spielsüchtigen helfen zu können, muss man also die Basisstörung behandeln.
Wie sehr sehen Sie den Staat als Regulator des Glücksspiels in der Pflicht?
Es ist absolut notwendig, dass der Staat als Regulator auftritt. Man darf nicht vergessen, dass mit den Spielsüchtigen auch andere ins Elend gerissen werden. Wenn sich jemand etwa hoch verschuldet, ist das ganze Umfeld mitbetroffen. Der Staat verdient mit dem Spielen viel Geld. Deshalb muss er auch für gute Steuerungsmechanismen sorgen.
In Liechtenstein ist die Eröffnung von zwei oder sogar drei Casinos geplant. Ist die Gefahr grösser, dass es mehr Spielsüchtige gibt, wenn das Spielangebot grösser ist?
Erst einmal muss man sehen, dass es niemals eine Gesellschaft ohne Glücksspiele oder Drogen geben wird. Man muss einfach dafür sorgen, dass die Drogen kultiviert eingenommen werden. Wenn Alkohol ritualisiert in Gesellschaft eingenommen wird, anstatt blind und reflexhaft, dann ist die Gefahr, in eine Sucht abzurutschen, bedeutend kleiner. Beim Spielen ist das nicht anders. Spielen in Casinos ist in einen Rahmen eingebunden, man muss seinen Ausweis vorzeigen und sich vielleicht noch eine Krawatte umbinden. Hier ist das Spielen kultiviert. Am Computer kann man zu jeder Tages, und Nachtzeit spielen, das ist sehr unkultiviert. Es gibt aber auch Menschen, die nicht unbedingt nur das Spiel suchen, sondern die spezielle Atmosphäre eines Casinos schätzen, und einfach für eine Weile in eine andere Welt eintauchen wollen. Negativ an einer hohen Dichte an Casinos ist daher, dass es mehr Spielcasinosüchtige gibt, da die Griffnähe sehr hoch ist.